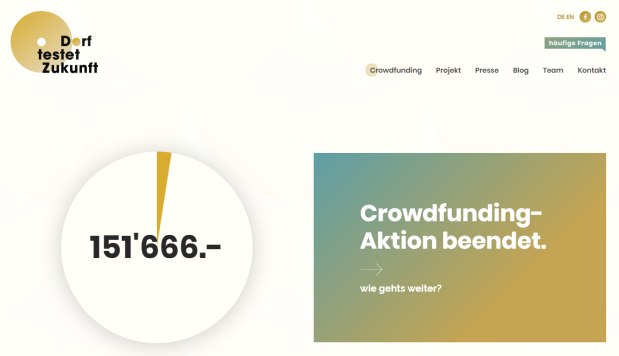Auf allen Kanälen prasselt ein unaufhörliches Trommelfeuer negativer Nachrichten aus aller Welt auf uns ein: Verbrechen, Terroranschläge, Naturkatastrophen, Krieg, Armut, Umweltzerstörung, Sexismus, Massenentlassungen. Die guten Nachrichten schaffen es seltener in die Nachrichtensendungen und Zeitungsspalten. Aber es gibt sie, und wie! «Die Zahl der Menschen in extremer Armut ist gestern um 137000 gesunken» – diese Schlagzeile hätte man in den letzten 25 Jahren an jedem einzelnen Tag auf die Titelseite setzen können, stellt Max Roser fest. Der Forscher an der Universität Oxford sammelt auf seiner Website OurWorldinData.org Daten zur Entwicklung der Welt.
Demnach ist die Faktenlage eindeutig: Die Welt verändert sich zum Guten, das Leben der Menschen verbessert sich in allen möglichen Bereichen – Lebenserwartung, Kindersterblichkeit, Gesundheit, Gleichberechtigung, Lebensstandard, Schulbildung, Zugang zu Elektrizität und Internet, Toleranz gegenüber Homosexualität. Aber zum Beispiel in Schweden denken nur 10 Prozent der Befragten, die Welt werde besser, in den USA 6 und in Deutschland 4 Prozent, wie eine Umfrage zeigt. Die Pessimisten in den reichen Ländern wissen dabei am wenigsten gut Bescheid.
Wie kommt es zu dieser massiven Wahrnehmungsstörung? Vor allem Berichte über langsame, allmähliche Verbesserungen schaffen es nur selten auf die Titelseiten, selbst wenn sie Millionen Menschen betreffen. Wir sind durch die Evolution darauf getrimmt, auf mögliche Gefahren zu reagieren. Negative Meldungen wecken deshalb mehr Interesse als positive. «Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten», das ist nicht einfach Zynismus der Journalisten.
Zudem gehört Alarmismus zum Geschäftsmodell politischer Aktivisten, Lobbyisten und Unternehmen, denn er bringt Spenden und Aufträge. Eine Studie von Psychologen der Harvard University liefert einen weiteren Grund für Wahrnehmungsfehler. In einem Experiment mussten die Teilnehmer bedrohliche Gesichter neben neutralen und freundlichen identifizieren. Je weniger bedrohliche auftauchten, desto mehr neutrale wurden als bedrohlich eingestuft. Wenn Probleme seltener werden, definieren wir automatisch mehr Dinge als problematisch.
Die Feststellung, dass wir grosse Fortschritte gemacht haben, heisst nicht, den Blick von all den vorhandenen Problemen abzuwenden. Im Gegenteil, so Max Roser: Wir wissen, dass es möglich ist, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, weil wir es bereits getan haben.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen frohe Weihnachten!
Dieser Beitrag erschien zuerst in der SonntagsZeitung vom 23. Dezember 2018